Publikationen
-
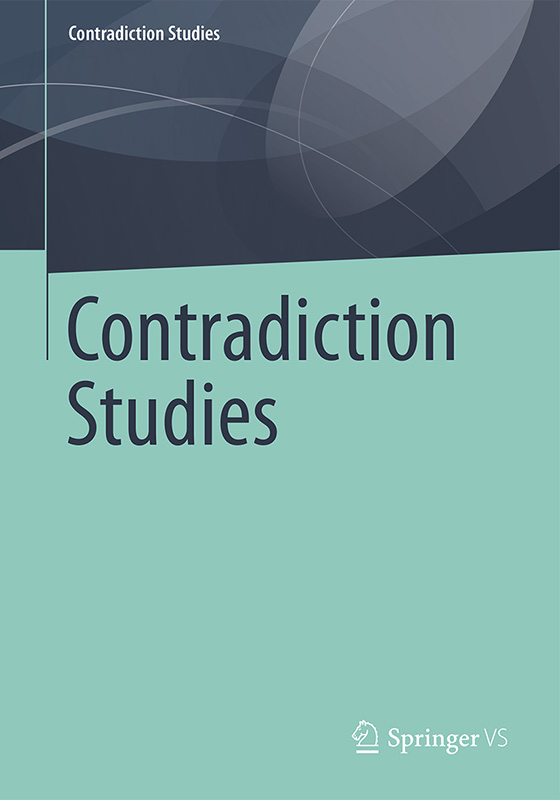 Contradiction Studies
Contradiction StudiesPutting contradiction center stage, this series aims at challenging simplistic conceptualizations of the contradictive. The series editors agree that contradictions are not necessarily about being resolved but that they rather provide starting points for polyphonic conversations. Contradiction Studies is meant as an invitation to reflect on the power of contradiction, fostering dialogue between the humanities, cultural studies, and social sciences.
-
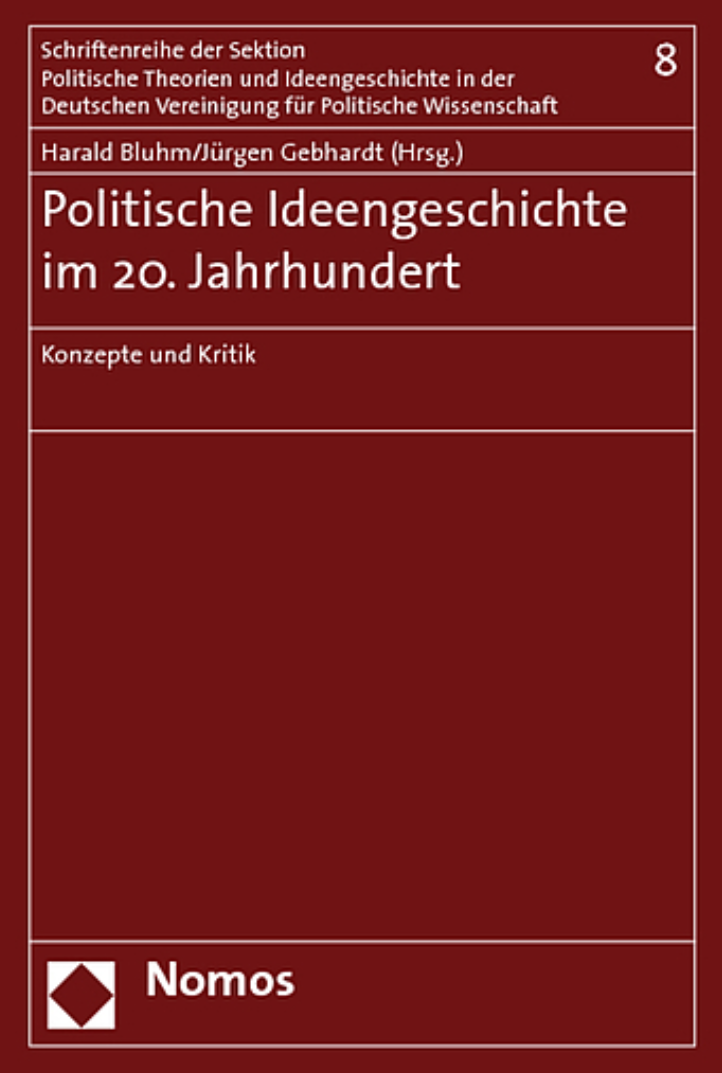 Politische Ideengeschichte und politische Hegemonie. Anmerkungen zum ‚Battle of the Books‘ an den amerikanischen Colleges
Politische Ideengeschichte und politische Hegemonie. Anmerkungen zum ‚Battle of the Books‘ an den amerikanischen Colleges
-
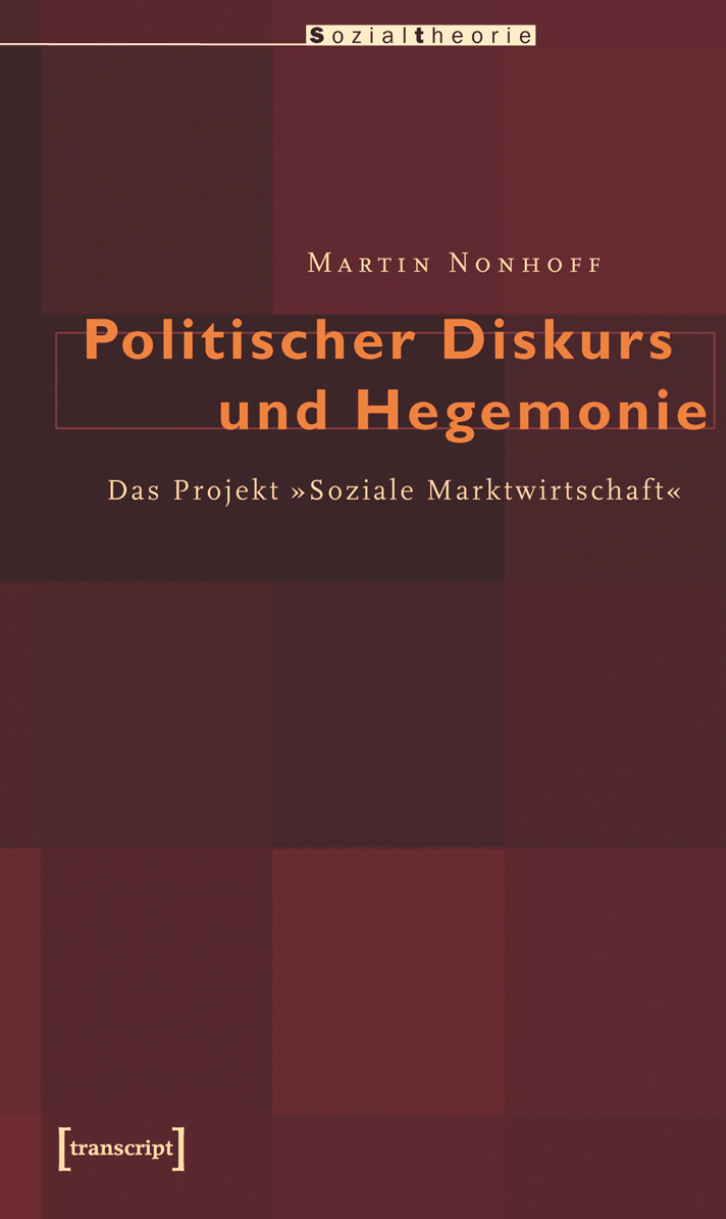 Politischer Diskurs und Hegemonie. Das Projekt »Soziale Marktwirtschaft«
Politischer Diskurs und Hegemonie. Das Projekt »Soziale Marktwirtschaft«Wie entstehen dominante politische Sprach- und Denkmuster und wie hängen sie mit den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zusammen? Diesen Fragen nach dem Funktionieren diskursiver Hegemonien will der vorliegende Band unter der Verknüpfung von Politik- und Diskurswissenschaft auf den Grund gehen. Anhand der Untersuchung des hegemonialen Projekts »Soziale Marktwirtschaft« werden die politisch-diskursiven Charakteristika und Strategien erfolgreicher Hegemonien rekonstruiert. Zudem veranschaulicht die exemplarische Analyse des westdeutschen wirtschaftspolitischen Diskurses der Nachkriegsjahre, wie die Politikwissenschaft von diskurswissenschaftlicher Forschung profitieren kann.
-
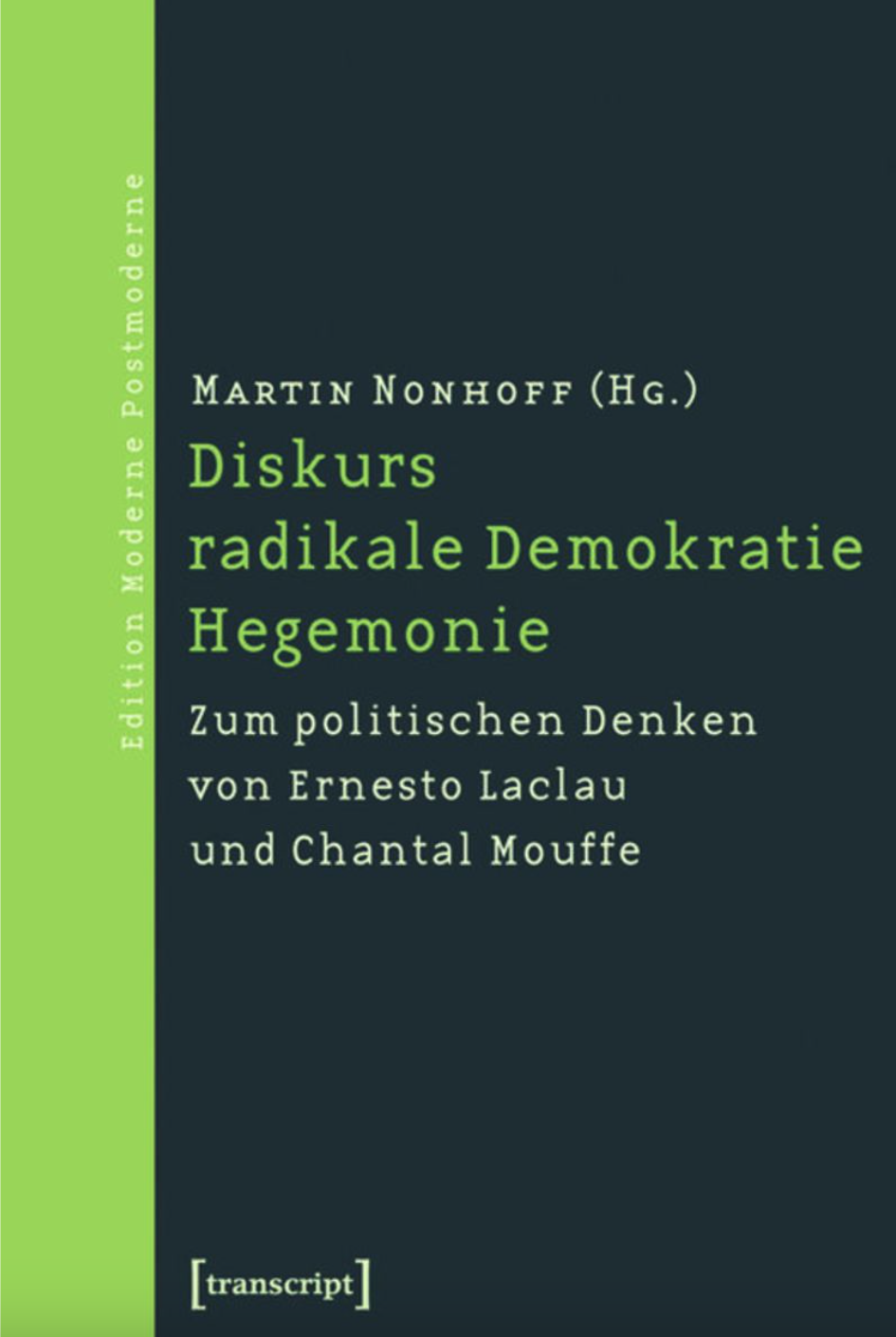 Diskurs – radikale Demokratie – Hegemonie.
Diskurs – radikale Demokratie – Hegemonie.Wenige politische Denker haben den internationalen politik- und sozialwissenschaftlichen Theoriediskurs der vergangenen Jahre so beeinflusst wie Chantal Mouffe und Ernesto Laclau – über Paradigmengrenzen hinweg. Beide verknüpfen neo-gramscianische, (post-)strukturalistische und psychoanalytische Theorieelemente und ermöglichen damit einerseits eine Erklärung von Ereignissen des politisch-diskursiven Geschehens, insbesondere der Ausbildung von Hegemonien, und andererseits eine normative Theorie der agonalen Demokratie.
Die Beiträge dieses Bandes geben einen Überblick über wesentliche Denkfiguren von Laclau und Mouffe, setzen sich mit diesen kritisch auseinander und zeigen methodische und empirische Anschlussmöglichkeiten auf.
Dieser Band enthält u.a. Originaltexte von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe.
-
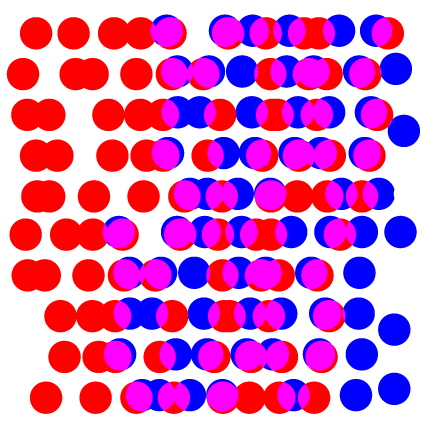 „Sascha, ich würde Dir gern glauben, aber versteh auch Du mich …“. Breschnew, Dubček und die Frage von Kadern und Vertrauen im Konflikt um den Prager Frühling 1968
„Sascha, ich würde Dir gern glauben, aber versteh auch Du mich …“. Breschnew, Dubček und die Frage von Kadern und Vertrauen im Konflikt um den Prager Frühling 1968Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Frage, mit welcher Art von Diplomatie wir es in den Warschauer-Pakt-Staaten zu tun haben. Am Beispiel der Invasion in der Tschechoslowakei 1968 werden drei Thesen diskutiert: (1) Breschnew übertrug sein innerparteiliches Konzept des „Kadervertrauens“ und sein auf Vertrauen basierendes „Machtszenario“ auf die Außenpolitik und behandelte Dubček als Klienten, den er patrimonial und familiär ansprach. (2) Er verlor das Vertrauen in Dubček, als dieser einen neuen demokratischen Diskurs etablierte, der die zentrale Macht der Partei leugnete. (3) Die diplomatische Sprache innerhalb der Warschauer-Pakt-Staaten bezog sich mehr auf die gemeinsamen sozialistischen Werte und die Parteidisziplin als auf die Sprache und den Rahmen der internationalen Treffen mit Drittstaaten.
-
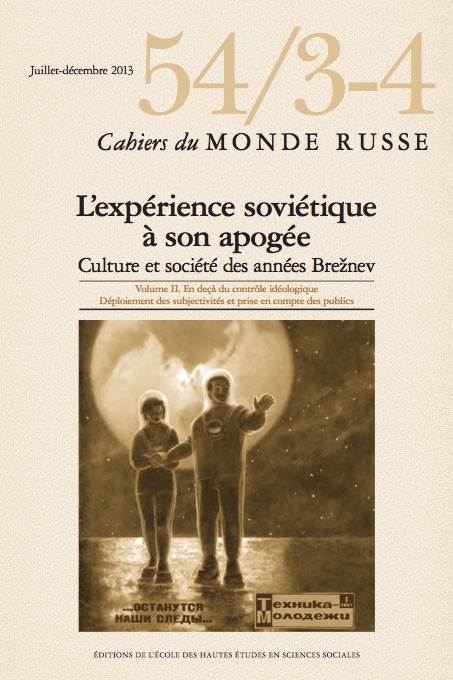 Les frontières du dicible. Du dialogue au silence: Les relations d’Andrej Saharov avec Hrušcev et Brežnev.
Les frontières du dicible. Du dialogue au silence: Les relations d’Andrej Saharov avec Hrušcev et Brežnev.This article describes the historical context that was decisive in Saharov’s commitment to warning party leaders of the dangers of the H-bomb and calling on them to respect human rights. He also attempts to explore the different ways in which Hruščev and Brežnev approached Saharov’s criticisms. Not only does he examine the three stages of the KGB model – educate, warn and only finally arrest renegades – he also sheds light on Andropov’s repeated appeals to Brežnev to speak with Saharov. Although Saharov, too, was keen to talk to Brežnev, the meeting between the two men never took place. In the end, it was against the backdrop of the Cold War that the Politbjuro decided on the best time to get rid of Saharov, doing as little damage as possible to the prestige of the Soviet Union, and thus re-establishing the limits of the dictable.
-
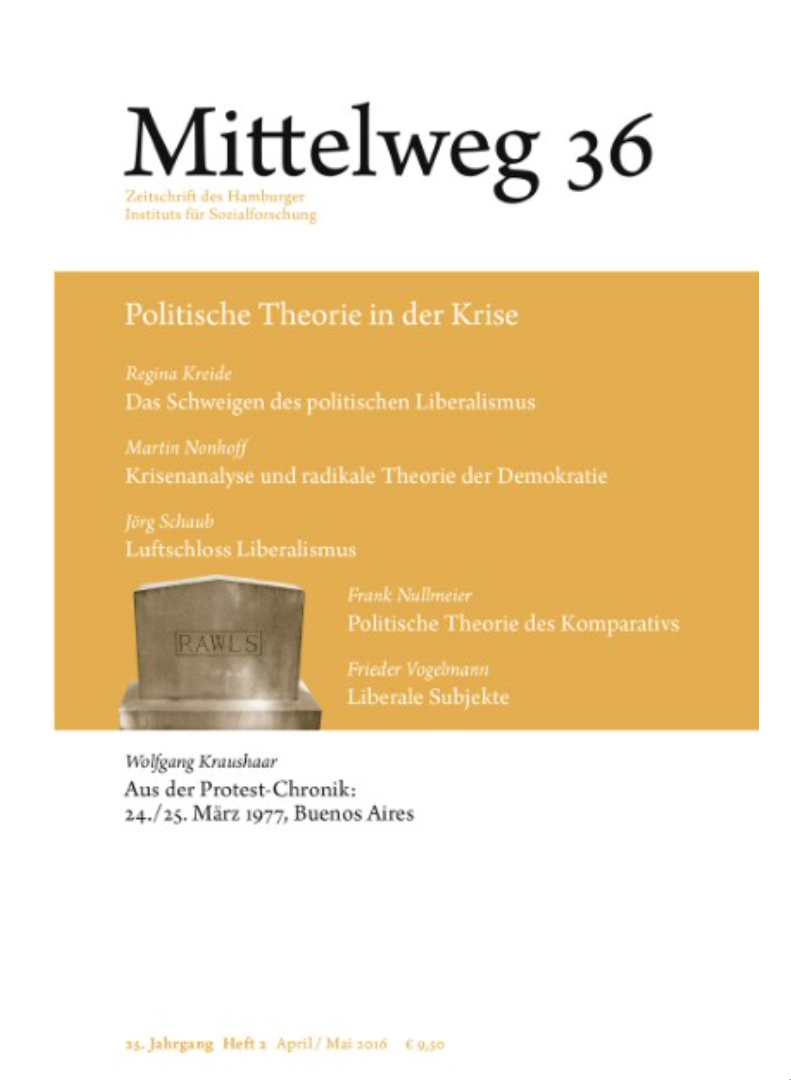 Politische Theorie in der Krise
Politische Theorie in der KriseMartin Nonhoff/Frieder Vogelmann: Editorial (Seite 3); Regina Kreide: Das Schweigen des politischen Liberalismus (Seite 5); Martin Nonhoff: Krisenanalyse und radikale Theorie der Demokratie (Seite 21); Jörg Schaub: Luftschloss Liberalismus. Warum das Denken in Krisenzeiten keinen Halt findet (Seite 38); Frank Nullmeier: Politische Theorie des Komparativs. Soziale Vergleiche und gerechte Gesellschaft (Seite 56); Frieder Vogelmann: Liberale Subjekte Eine affirmative Streitschrift (Seite 74); Wolfgang Kraushaar: Aus der Protest-Chronik: 24./25. März 1977, Buenos Aires (Seite 91)
-
 Krisenanalyse und radikale Theorie der Demokratie
Krisenanalyse und radikale Theorie der Demokratie
-
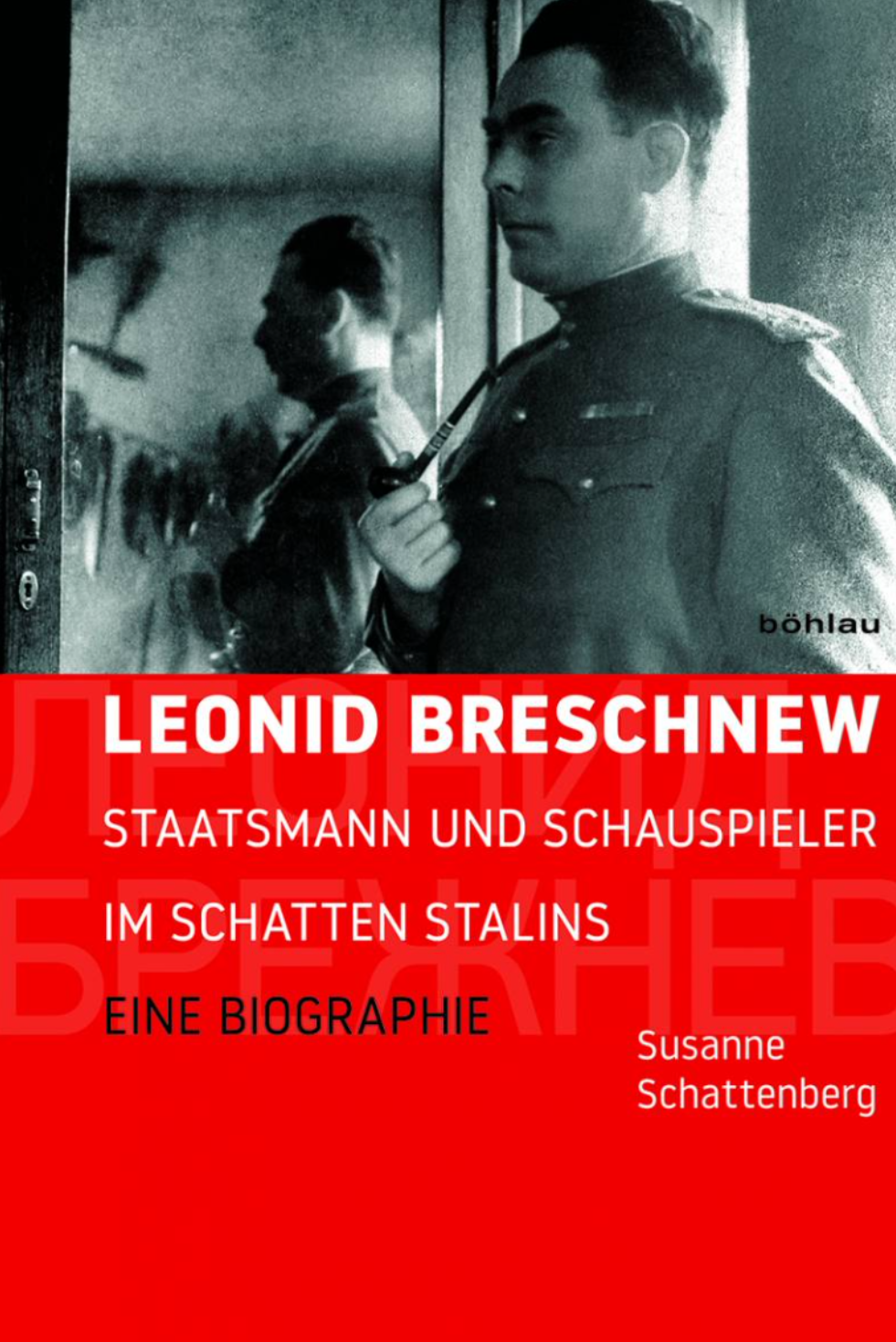 Leonid Breschnew. Staatsmann und Schauspieler im Schatten Stalins. Eine Biographie
Leonid Breschnew. Staatsmann und Schauspieler im Schatten Stalins. Eine BiographieLeonid Breschnew war von 1964 bis 1982 Vorsitzender der KPdSU und prägte fast zwei Jahrzehnte lang die Entwicklung der Sowjetunion. Anders als im Westen lange behauptet, war Breschnew kein Hardliner oder Restalinisierer , sondern hatte selbst unter Stalin gelitten und so viel Leid gesehen, dass er Wohlstand für alle zur Generallinie der Partei erklärte. Das Grauen, das er im Zweiten Weltkrieg erlebt hatte, ließ ihn den Ausgleich mit dem Westen suchen. Breschnew mimte den westlichen Staatsmann und wurde von seinen Partnern als einer der ihren akzeptiert. Doch als 1974 Georges Pompidou starb und Willy Brandt sowie Richard Nixon zurücktraten, sah sich Breschnew vor dem Trümmerhaufen seiner Entspannungspolitik. Denn, was im Westen niemand ahnte, im Kreml gab es keinen politischen Kurswechsel. Stress und Schlaflosigkeit führten Breschnew in eine Tablettensucht, die seine Friedensbemühungen weiter ruinierte: Den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan 1979 entschied eine Politbüro-Troika ohne ihn.
Ein Mensch in seiner Zeit : Die Osteuropahistorikerin Susanne Schattenberg legt, basierend auf zahlreichen bislang nicht zugänglichen Quellen, die erste wissenschaftliche Biographie über Leonid Breschnew vor zu seinem 35. Todestag im November 2017.
-
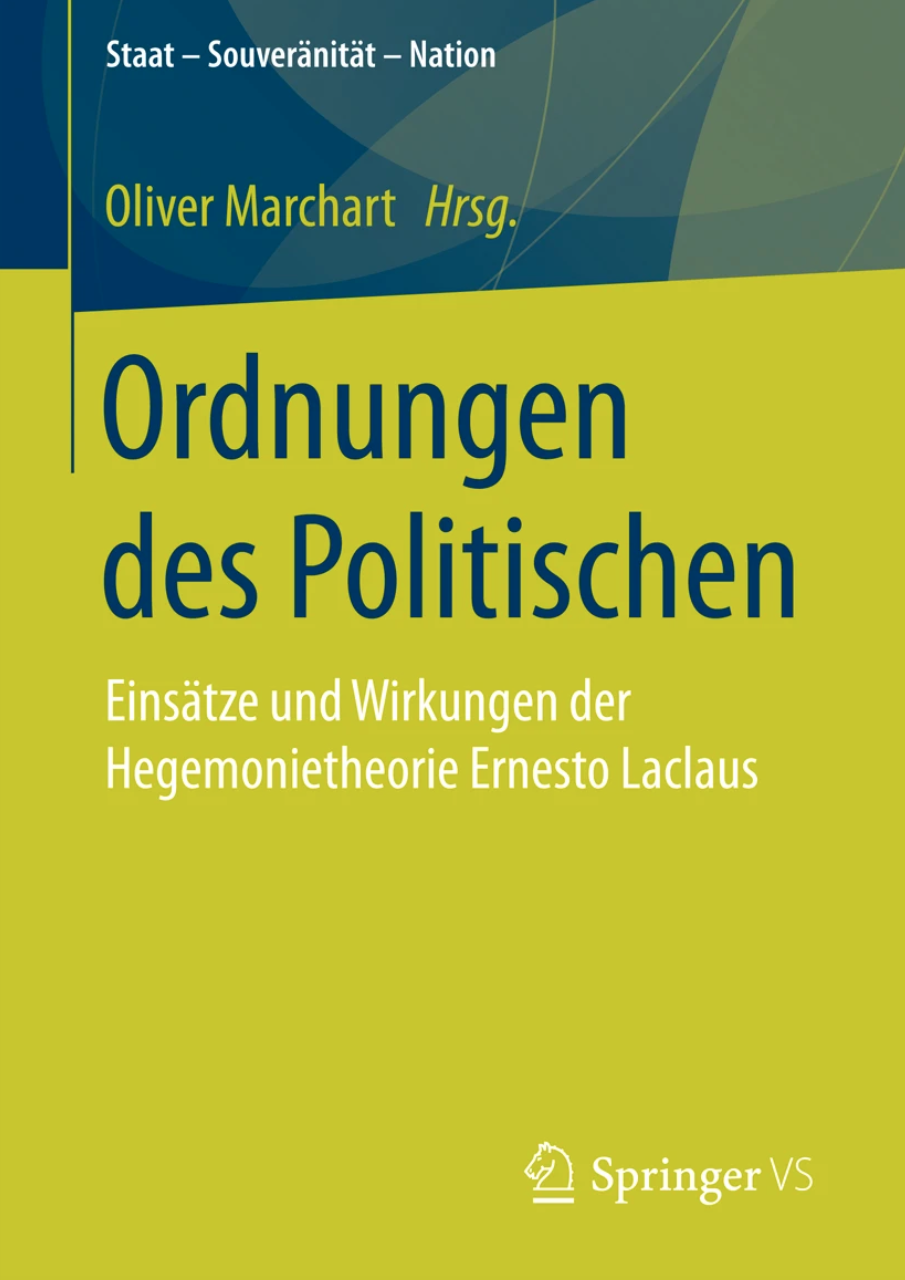 Antagonismus und Antagonismen – hegemonietheoretische Aufklärung
Antagonismus und Antagonismen – hegemonietheoretische Aufklärung
-
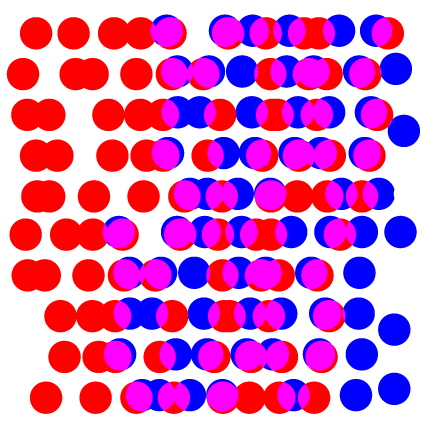 Discourse Analysis as Critique
Discourse Analysis as CritiqueThis paper intervenes in the discussion about the relationship between discourse analysis and critique. It argues that this relationship can be understood either as an external or as an integrated relationship. In an external relationship, there is first social criticism that is then braced by discourse analysis, that is, the latter aims at giving empirical credence to the critique. However, such an external relationship cannot give us any insight concerning the critical potential that is specific to discourse analysis, precisely because in this case critique exists before and independent of discourse analysis. If, however, critique emanates from discourse analysis itself, we would speak of an integrated relationship and would no longer speak of discourse analysis and critique, but of discourse analysis as critique. It is argued that such an integrated relationship becomes visible once we think of discourse analysis as being itself a discursive formation and ask what unsettling effects this formation has on research objects, on subject formations and on the academic production context in which they are conducted.
-
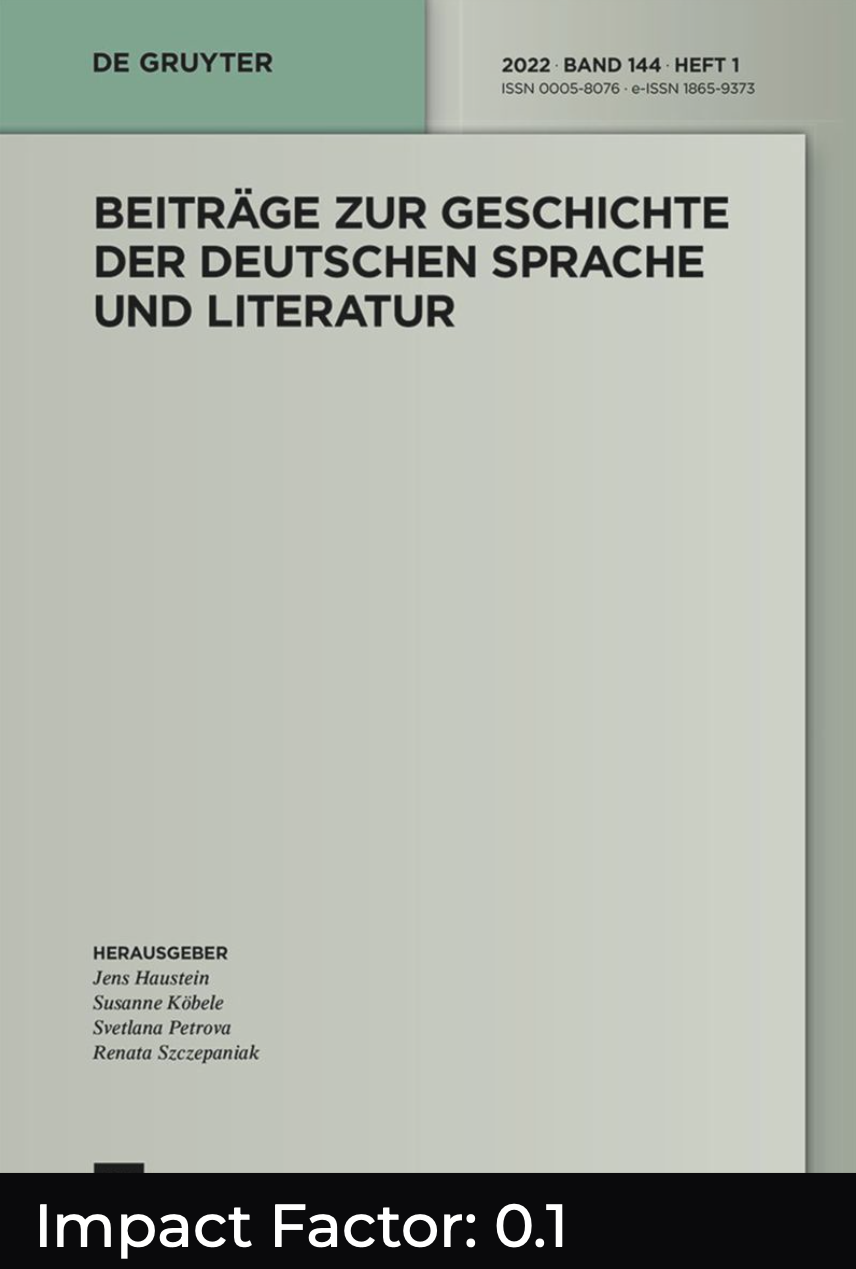 Widerspruch als Erzählprinzip in der Vormoderne? Eine Projektskizze
Widerspruch als Erzählprinzip in der Vormoderne? Eine ProjektskizzeIn premodern narratives contradictions are omnipresent – conflicting concepts, logical inconsistencies, acts of objection. In a narratological perspective ›contradiction‹ – conflicts of incompatible knowledges and narrative patterns; inconsistencies in or between speech (by narrator or characters) and action; contradictory or inconsistent information and motivation – is apt to subvert, complicate, or enrich the textual production of meaning. The project ›Contradiction as a Narrative Principle in Premodern Narrative‹ (University of Bremen) explores different types of contradictions in medieval epic and romance.
-
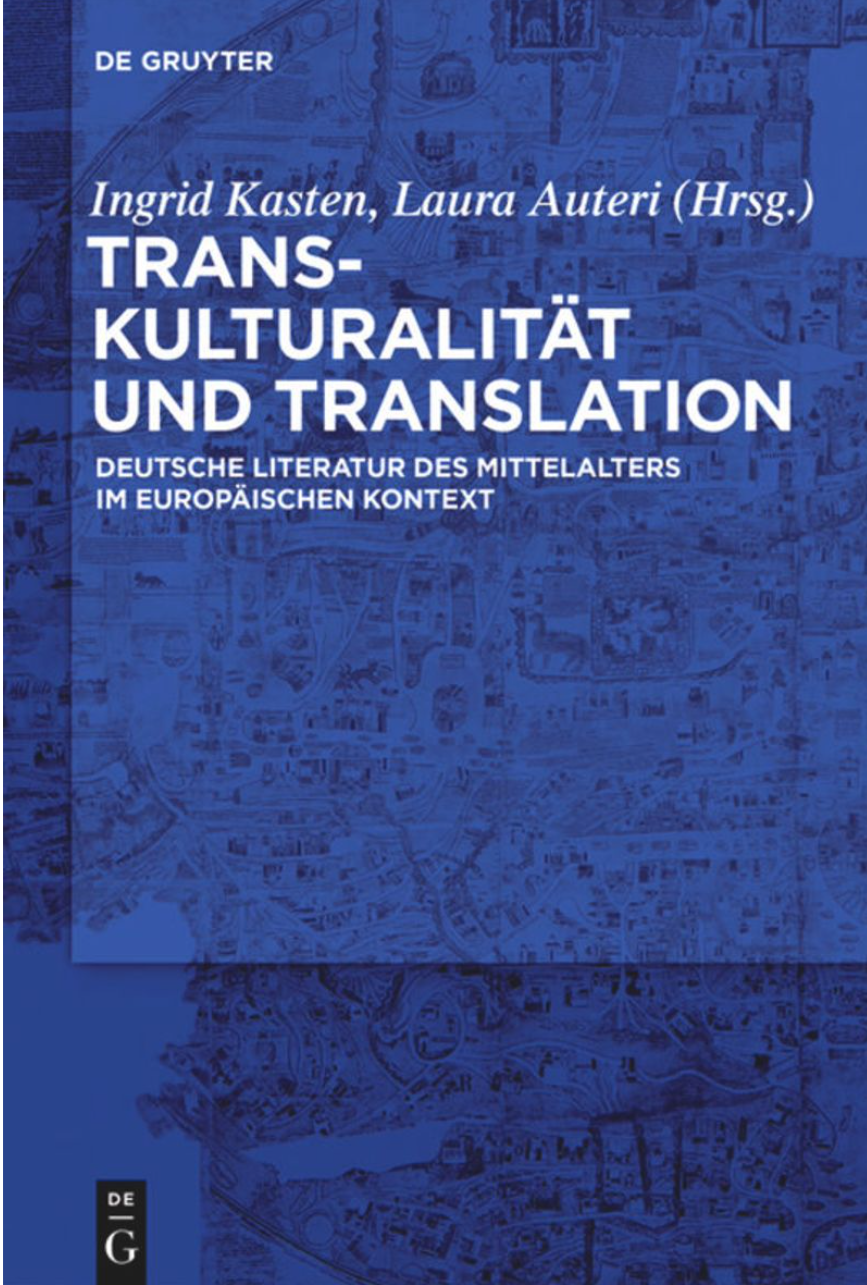 Erzählen in transkultureller Perspektive. Zur Poetologie der Widersprüche in der europäischen Heldendichtung
Erzählen in transkultureller Perspektive. Zur Poetologie der Widersprüche in der europäischen Heldendichtung
-
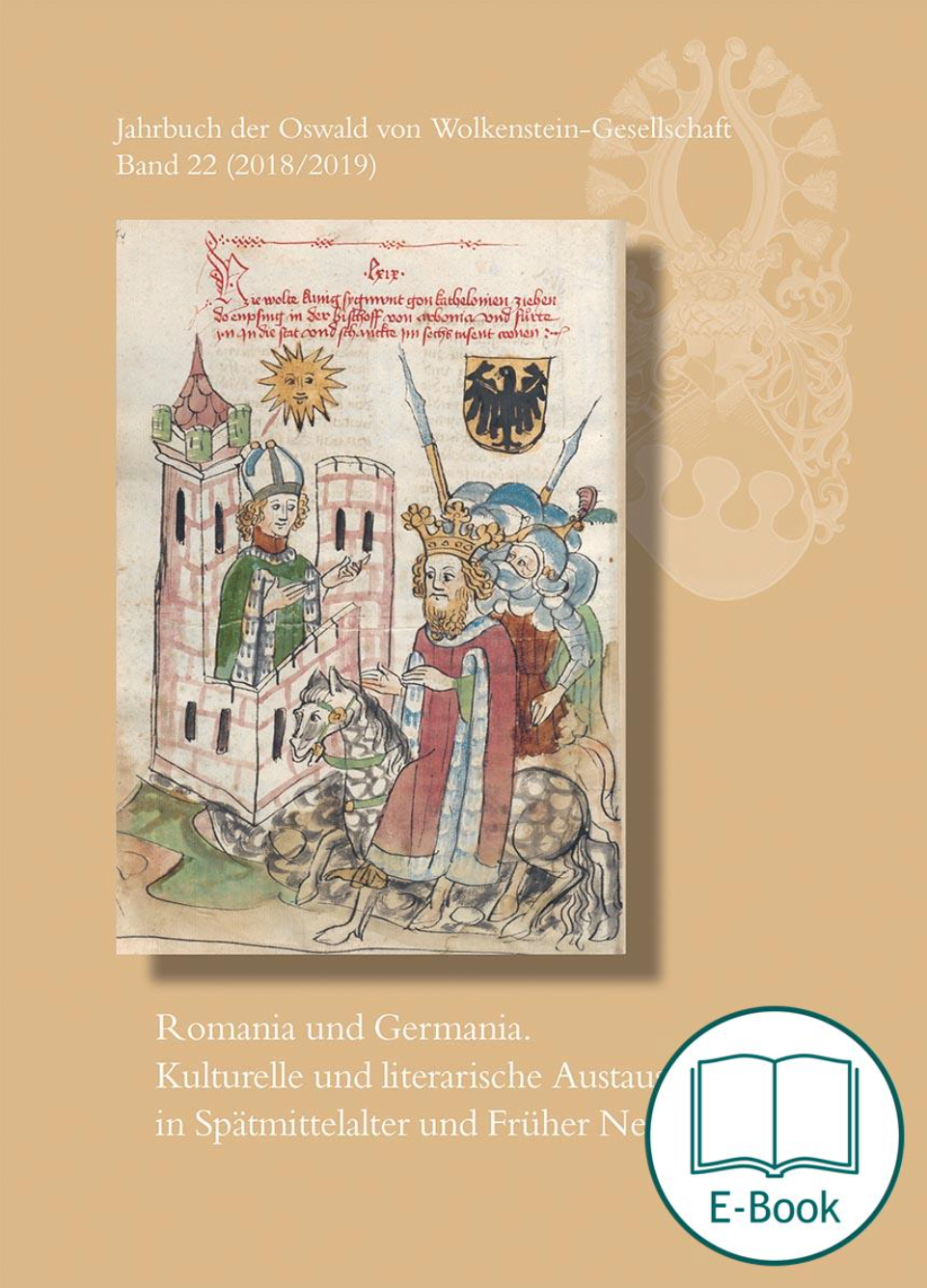 Erzähllogiken transnational. Narratologische Aspekte der Rezeption französischer Heldenepik in frühneuhochdeutscher ProsaErzähllogiken transnational
Erzähllogiken transnational. Narratologische Aspekte der Rezeption französischer Heldenepik in frühneuhochdeutscher ProsaErzähllogiken transnational
-
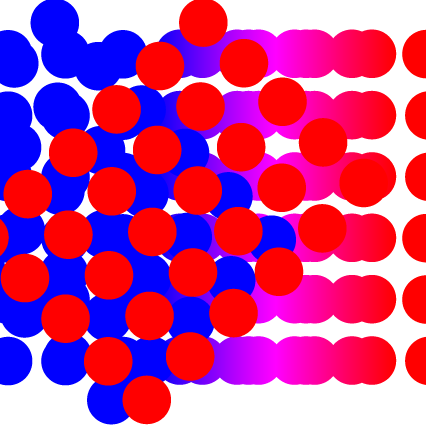 „Wildekeit“ und Widerspruch. Poetik der Diskrepanz bei Konrad von Würzburg
„Wildekeit“ und Widerspruch. Poetik der Diskrepanz bei Konrad von Würzburg
-
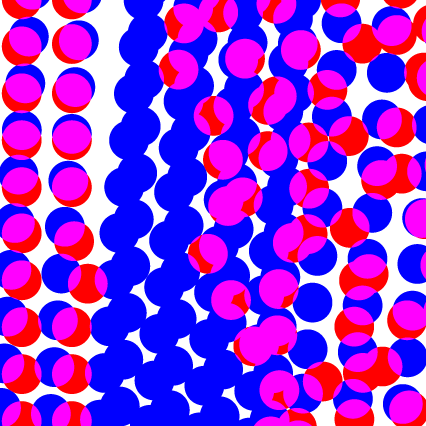 Antagonisten im höfischen Roman? Eine Skizze
Antagonisten im höfischen Roman? Eine SkizzeDer Beitrag skizziert Darstellung und vielfältige Funktionen ausgewählter Gegenfiguren im höfischen Roman um 1200. Vom Antikenroman abgesehen begegnen nur selten Gegenspieler auf Augenhöhe, die ein entgegengesetztes Wertsystem repräsentieren und konsequent bis zum Ende gegen den Helden agieren. Die Texte sind protagonistenzentriert; ein gleichwertiges narratives Gegenüber wird kaum entworfen. Insofern wäre der Begriff ‘Antagonist’ für Artus-, Gral- und Tristanroman zu hinterfragen.
-
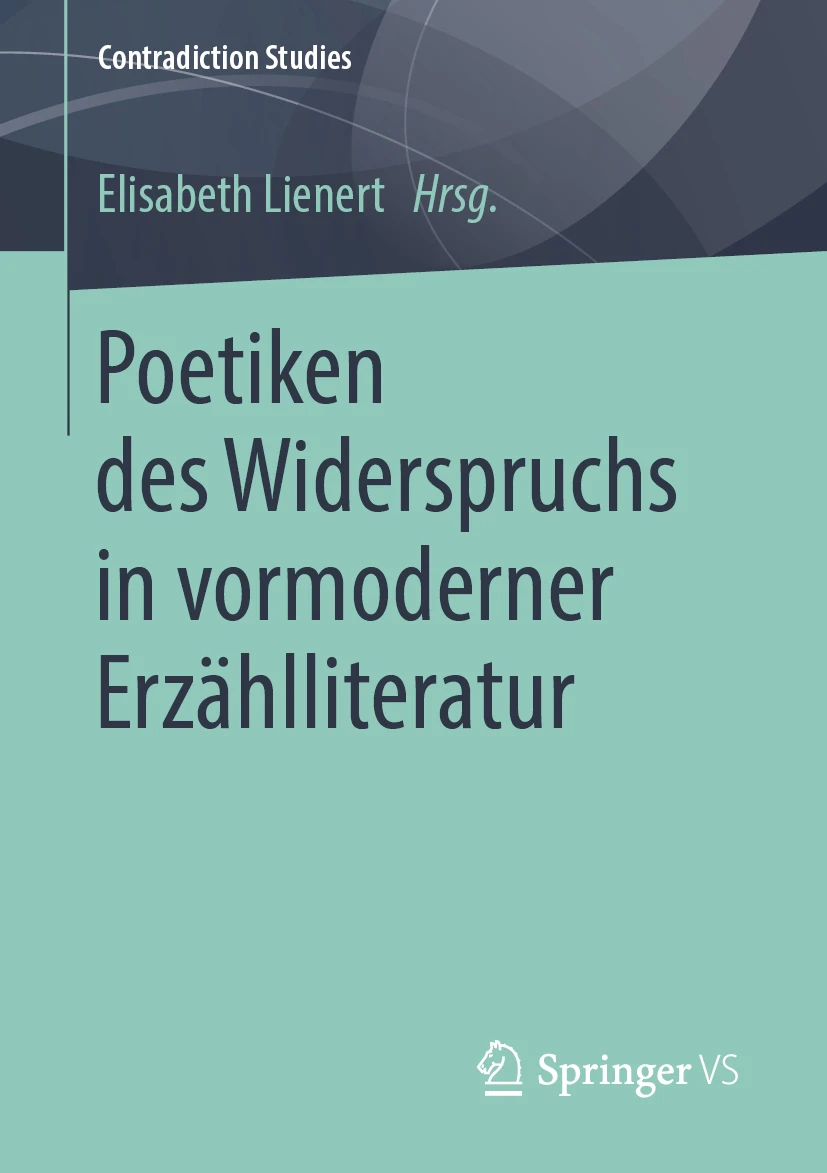 Poetiken des Widerspruchs in vormoderner Erzählliteratur
Poetiken des Widerspruchs in vormoderner ErzählliteraturDieser Band enthält grundsätzliche Überlegungen und textbezogene Fallstudien zu poetologischen Potenzialen von Widersprüchen und Verwandtem in deutschen und europäischen Erzähltexten vom 12. bis zum 17. Jahrhundert. Untersucht werden Akte der Widerrede und Phänomene der Unvereinbarkeit, widersprüchliche Konzeptualisierungen und narratologische Brüche, epistemologische Bedingungen der Wahrnehmung von Widersprüchlichkeit, Aspekte einer Poetologie des Widerspruchs als Mittel der Sinnkomplexion.
-
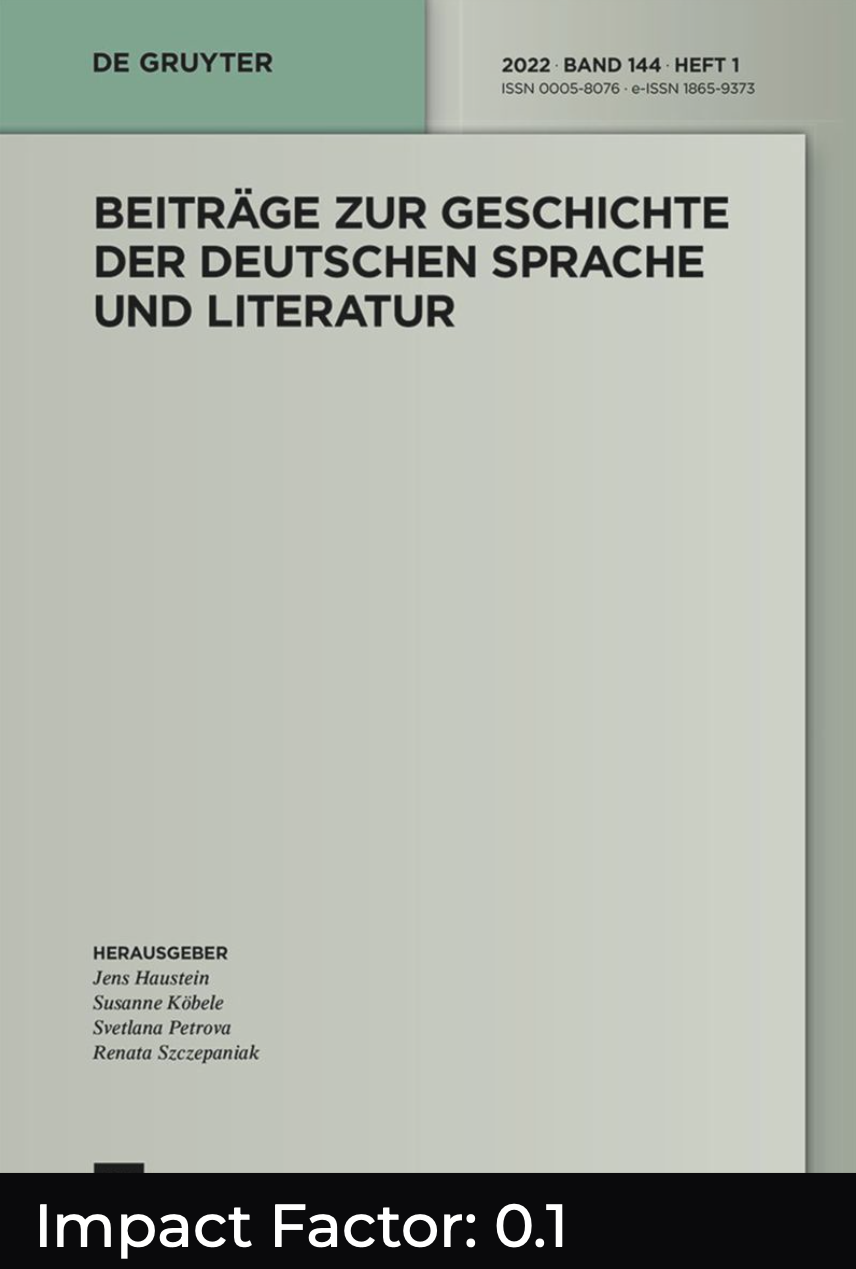 Widersprüche in heldenepischem Erzählen
Widersprüche in heldenepischem ErzählenThis article (re-)examines (marked) inconsistencies and incompatibilities in Middle High German heroic epic. Those contradictions may result from oral tradition, from the difficulties of transfering oral narratives into literacy, from the conditions of performing from memory, or from traditional narrative regularities of the genre. Frequently, they are striking side effects of a type of narration which is paradigmatic instead of syntagmatic, elliptic and aggregative, scenic and final, and therefore highly tolerant against contradictions of any kind. Contradictions and inconsistencies are (consciously or unconsciously) used (and imitated) as one of the constitutive stylistic features of heroic epic. In some cases, moreover, contradictions and inconsistencies are obviously part of an intentional poetics of contradiction ostentatiously accumulating and exhibiting different layers of knowledge and meaning. The textual strategies of heroic epic, in some respect perhaps of premodern narration in general, tend to favour discrepancies, contrasts, and contradiction instead of nuances, compromises, and smooth transitions.
-
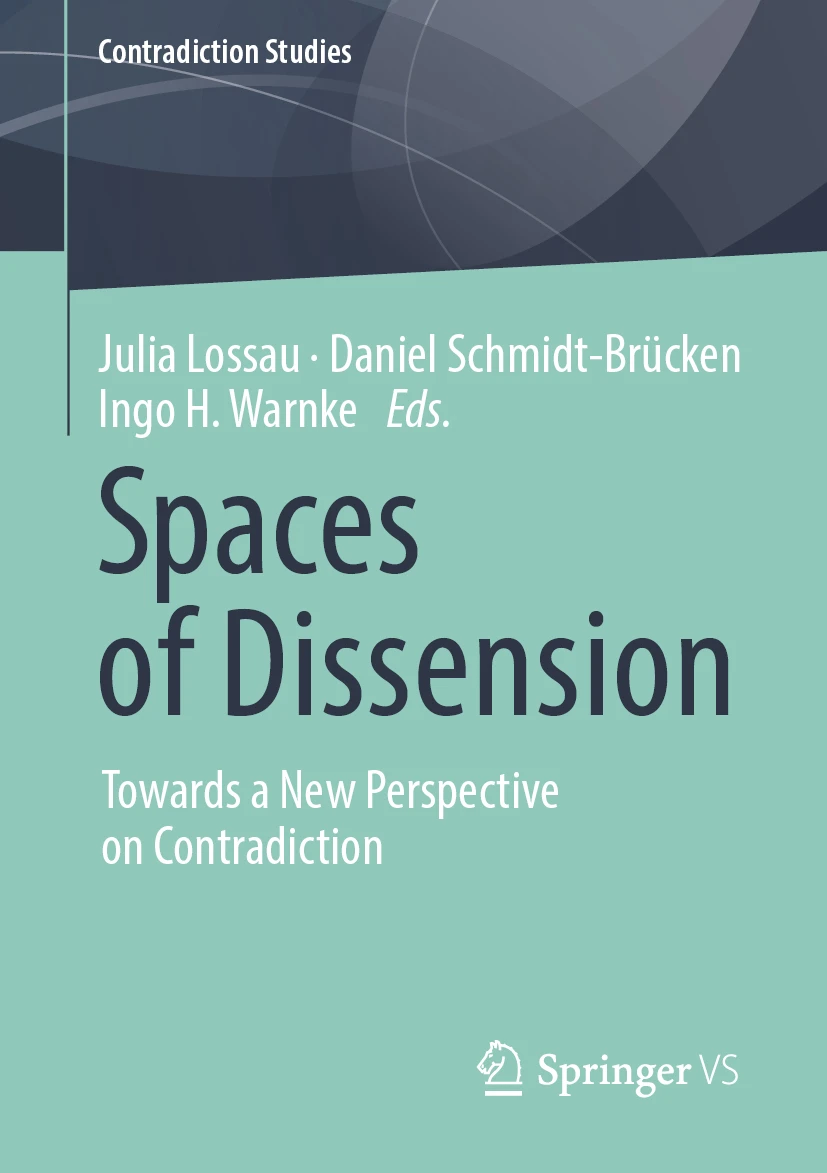 Knowledges and Contradictions in Premodern Narratives
Knowledges and Contradictions in Premodern NarrativesContradiction is not just a (post-)modern phenomenon. In premodern narratives, conflicting concepts and logical inconsistencies are omnipresent. This paper focuses on contradictions interdependent with knowledge: Traditional narratives may aggregate different versions of matters rooted in collective memory (heroic epic) or authoritative sources (romances of antiquity), sometimes without concern for the consistency of their own story. Narrative texts may use contradiction for didactic purposes. Contradictions may result in both construction and deconstruction of knowledge. Strategies of irritation and ambiguity involve recipients in the production of meaning. Thus, the concept of contradiction is apt to redefine premodern narrative strategies.
-
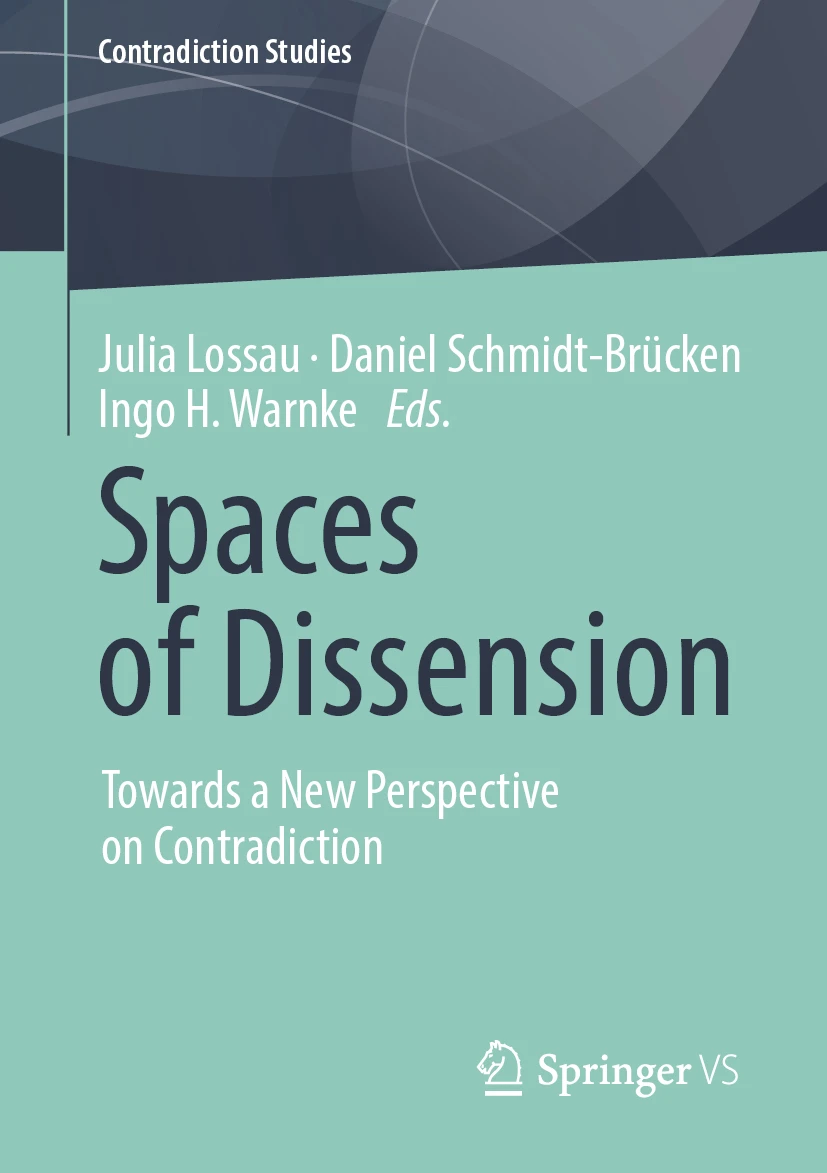 Spaces of Dissension
Spaces of DissensionThis volume focusses on contradiction as a key concept in the Humanities and Social Sciences. By bringing together theoretical and empirical contributions from a broad disciplinary spectrum, the volume advances research in contradiction and on contradictory phenomena, laying the foundations for a new interdisciplinary field of research: Contradiction Studies. Dealing with linguistic phenomena, urban geographies, business economy, literary writing practices, theory of the social sciences, and language education, the contributions show that contradiction, rather than being a logical exemption in the Aristotelian sense, provides a valuable approach to many fields of socially, culturally, and historically relevant fields of research.